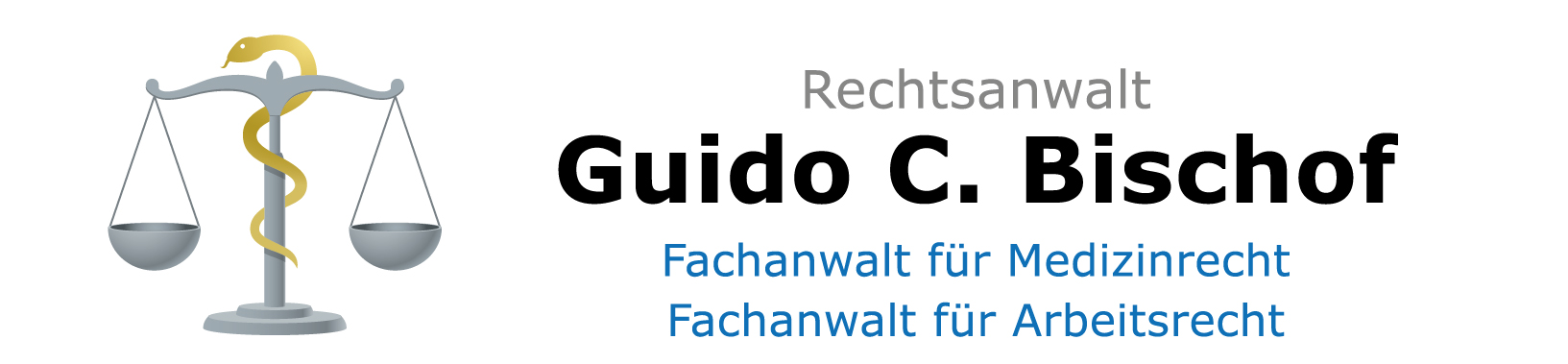Rettungsdienst-Recht
Guido C. Bischof verantwortet Kapitel in medizinrechtlichem Kompendium
Der C. F. Müller-Verlag hat kürzlich die 56. Aktualisierung zum Werk „Gesundheitsrecht – Kompendium für die Rechtspraxis“ veröffentlicht.
Damit enthält das Kompendium erstmals Kapitel zur Thematik „Rettungsdienst und Notfallversorgung“. Es ist einer der wenigen deutschsprachigen Fachbücher, in dem diese Thematik überhaupt behandelt wird. Verantwortlicher Autor ist Guido C. Bischof, Rechtsanwalt Fachanwalt für Medizinrecht und Notfallsanitäter.
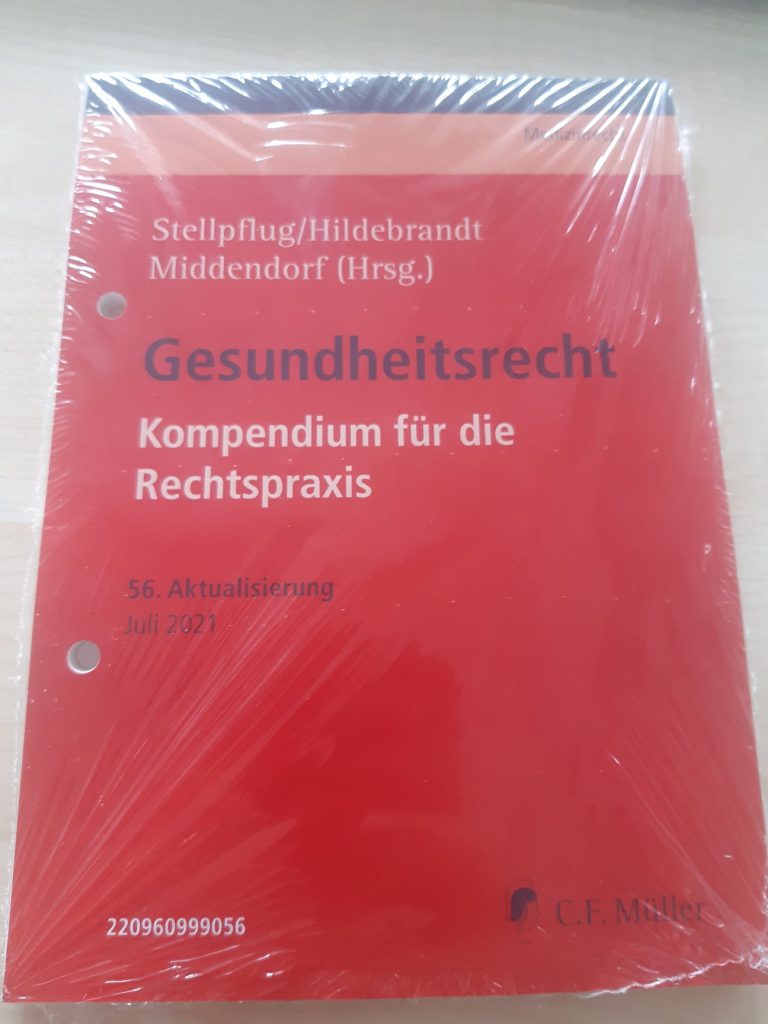
Beitrag Notfall- und Rettungsmedizin: Der Kompetenzbegriff
Unter dem Titel „Der Kompetenzbegriff – ein Aufruf zu mehr Differenziertheit“ erscheint in der Ausgabe 2/2021 der Zeitschrift Notfall- und Rettungsmedizin ein Beitrag, zudem auch ich einen (bescheidenen) Beitrag leisten durfte.
Der Kerninhalt des Beitrags ist mir dabei sehr wichtig: Um die „Kompetenz“ von Rettungsfachpersonal wird momentan häufig diskutiert. Dabei wird aber der Begriff Kompetenz regelmäßig völlig unterschiedlich genutzt. Das Resultat: Wir kommunizieren aneinander vorbei.
Persönlich möchte ich ergänzen: Und der ein oder andere hält Lautstärke dabei für wichtiger als Sachinhalte.
Der Beitrag ist online bereits verfügbar, jedoch kostenpflichtig: https://doi.org/10.1007/s10049-021-00845-5
Beitrag Im Einsatz: Kinder und Jugendliche im Einsatzgeschehen
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Im Einsatz“ aus dem S&K-Verlag findet sich ein Beitrag von mir zum Thema „Rechtliche Betrachtung für Einsatzkräfte und Betroffene: Kinder und Jugendliche im Einsatzgeschehen“.
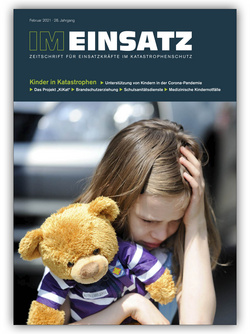
Ein Link zum Verlag findet sich hier.
In dem Beitrag befasse ich mich unter anderem mit minderjährigen NotSan-Auszubildenden und mit sonstigen minderjährigen Einsatzkräften.
„Noris nörgelt“ – Artikel zu arbeitsrechtlichen Dauerbrennern in der Zeitschrift Rettungsdienst
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Rettungsdienst aus dem S+K-Verlag beinhaltet einen Themenschwerpunkt „Rechtsfragen im Rettungsdienst“. Unter der Überschrift
„Noris nörgelt: Probleme mit Dienstplan, Überstunden und mehr“
habe ich mich mit arbeitsrechtlichen Dauerbrennern wie dem „Einspringen“, Überstunden durch Folgeeinsätze und dem Dienstplan auseinandergesetzt.
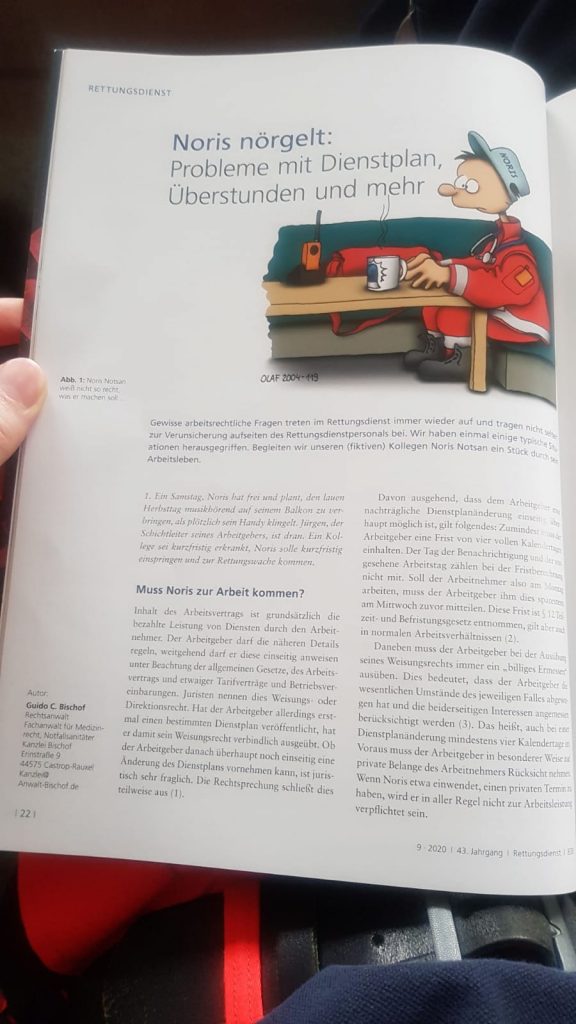
Arbeitsrecht: Corona/CoViD-19/SARS-CoV2 und Schutzkleidung
 Erstaunlicherweise erreichen mich regelmäßig Anfragen welche Schutzkleidung, insbesondere welche Masken, der Arbeitgeber in Zeiten von Corona/CoViD-19/SARS-CoV2 zur Verfügung stellen muss. Auch scheint eine große Verunsicherung da zu sein, welche Rechte Arbeitnehmer haben, wenn keine Schutzkleidung zur Verfügung steht.
Erstaunlicherweise erreichen mich regelmäßig Anfragen welche Schutzkleidung, insbesondere welche Masken, der Arbeitgeber in Zeiten von Corona/CoViD-19/SARS-CoV2 zur Verfügung stellen muss. Auch scheint eine große Verunsicherung da zu sein, welche Rechte Arbeitnehmer haben, wenn keine Schutzkleidung zur Verfügung steht.
Der Text steht auch als PDF zur Verfügung: CoVid-Arbeitsrecht-Stand 24.4.2020 .
Welche Schutzausrüstung muss der Arbeitgeber stellen?
Der Arbeitgeber[1] ist verpflichtet, angemessene Schutzkleidung zu stellen. Dies ergibt sich nicht nur aus Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung und aus § 4 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz, sondern auch bereits aus § 618 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Arbeitsrechtlich handelt es sich dabei um eine sogenannte „Nebenpflicht“ aus dem Arbeitsvertrag. Diese Nebenpflicht ist auch nicht dadurch zu ändern, dass sich der Arbeitgeber auf einen „Notstand“ beruft oder eine gesonderte Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer schließt. Durch die gesetzlichen Regelungen soll die Gefährdung für Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten werden.[2]
Was ist denn „angemessene Schutzkleidung“?
Welche Schutzkleidung der Arbeitgeber nun konkret stellen muss, ist eine Frage welche Ausstattung fachlich geboten ist.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt bei direkter Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher COVID-19-Infektion Schutzkittel, Atemschutzmaske (mindestens FFP2) und Einmalhandschuhe und je nach Exposition eine Schutzbrille[3].
Der „Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe“ (ABAS) beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt in seinem Beschluss 609[4] an, dass bei der Untersuchung, Behandlung, Pflege und Versorgung von Patienten, die an einem Influenza-Erreger der Risikogruppe 3 erkrankt sind oder die als Verdachtsfall gelten mindestens FFP2-Masken von den Beschäftigten zu tragen sind[5]. Zudem müssen Schutzkittel , Einmalhandschuhe und regelmäßig eine geeignete Schutzbrille verwandt werden[6].
Die eigentlich für die Influenza gedachten Empfehlungen sind auf den COVID-19-Erreger übertragbar[7], insbesondere ist auch COVID-19 in die Risikoklasse 3 eingestuft[8].
Zusammengefasst: Zur Versorgung von Patienten mit bestätigter oder wahrscheinlicher COVID-19-Infektion muss der Arbeitgeber Schutzkittel, Atemschutzmaske (mindestens FFP2), Einmalhandschuhe und eine Schutzbrille zur Verfügung stellen.
Lediglich als „Präventivmassnahme“ bei Patienten ohne konkreten Krankheitsverdacht ist ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend.
Darf man als Personal im Gesundheitswesen die Arbeit verweigern, wenn kein Infektionsschutzmaterial vorhanden ist?
Erfüllt der Arbeitgeber diese Schutzpflichten nicht, so steht dem betroffenen Arbeitnehmer ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 Abs. 1 BGB zu [9]. Praktisch bedeutet dies, dass der Arbeitnehmer seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen muss. Er hat aber dennoch einen Vergütungsanspruch.
Sollte also tatsächlich der Fall eintreten, dass der Arbeitgeber z. B. eine Patientenversorgung oder eine Patientenbeförderung mit zu erwartender Infektionsgefahr anweist, er aber zugleich keine ausreichende Schutzkleidung stellt, muss der Mitarbeiter dem nicht Folge leisten.
Wesentlich häufiger und realistisch dürfte aber die Situation sein, in denen sich der Arbeitnehmer ein Mehr an Schutzmaßnahmen wünscht, zum Beispiel eine FFP3-Maske bei jedem Patienten, statt nur einem chirurgischem Mundschutz. Insofern ist -wie oben dargestellt- entscheidend was fachlich aus hygienischer bzw. arbeitsmedizinischer Sicht zu fordern ist.
Mein Arbeitgeber sagt, es sei „unterlassene Hilfeleistung“ wenn ich Patienten nicht ohne ausreichenden Infektionsschutz versorgen will
Arbeitsrechtlich ist die Lage oben dargestellt, der Mitarbeiter kann bei vorhandener Infektionsgefahr und mangelnder Schutzausrüstung die Arbeit ablehnen.
Etwas problematischer kann die Sache strafrechtlich sein, wenn der Mitarbeiter bereits die Arbeit konkret aufgenommen hat, womöglich in Kenntnis mangelnder Schutzausrüstung, und die Patientenversorgung dann abbricht.
Aufgrund der vorhandenen Garantenstellung des Mitarbeiters kann diese Situation tatsächlich ein Strafbarkeitsrisiko bergen. Wegen der Details weise ich auf die Stellungnahme von Herrn Dr. Brock, Fachanwalt für Medizinrecht, für den Deutsche Berufsverband Rettungsdienst (DBRD) hin. Die strafrechtlichen Details sind dort, ab Seite 3, umfassend erläutert.[10]
Der Mitarbeiter kann das persönliche Strafbarkeitsrisiko dadurch vermeiden, dass er ohne hinreichende Schutzkleidung keine Patientenversorgung beginnt bzw. im Rettungsdienst keinen Einsatz bzw. Dienst übernimmt.
[1] Ich verwende weitestgehend das generische Maskulinum, eine Diskriminierung ist keinesfalls beabsichtigt.
[2] § 4 Nr. 1 ArbSchG, vgl. auch Wank in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 20. Aufl. 2020, BGB § 618 Rn. 14
[3] https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html, Abruf 20.4.2020
[4] https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBA/pdf/Beschluss-609.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Abruf 20.4.2020
[5] ABAS-Beschluss 609, Ziffer 6.3.1, Link siehe vor
[6] ABAS-Beschluss 609, Ziffern 6.2, 7.2, Link siehe vor
[7] https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-Coronavirus.html
[8] ABAS-Beschluss 1/2020, https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/pdf/SARS-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , Abruf 20.4.2020
[9] Wank in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 20. Aufl. 2020, BGB § 618 Rn. 25
[10] https://dbrd.de/images/aktuelles/2020/04-01/Stellungnahme_DBRD_Schutzausrustung.pdf , Abruf 20.4.2020