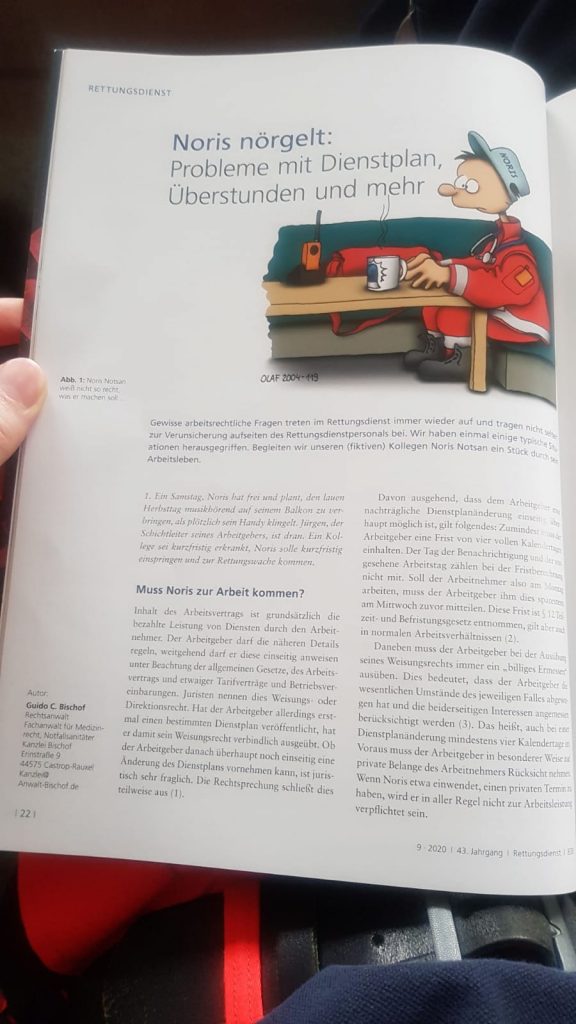Rettungsdienst-Recht
Geschützt: Rettungsdienstfortbildung in Oberhausen
Guido C. Bischof verantwortet Kapitel in medizinrechtlichem Kompendium
Der C. F. Müller-Verlag hat kürzlich die 56. Aktualisierung zum Werk „Gesundheitsrecht – Kompendium für die Rechtspraxis“ veröffentlicht.
Damit enthält das Kompendium erstmals Kapitel zur Thematik „Rettungsdienst und Notfallversorgung“. Es ist einer der wenigen deutschsprachigen Fachbücher, in dem diese Thematik überhaupt behandelt wird. Verantwortlicher Autor ist Guido C. Bischof, Rechtsanwalt Fachanwalt für Medizinrecht und Notfallsanitäter.
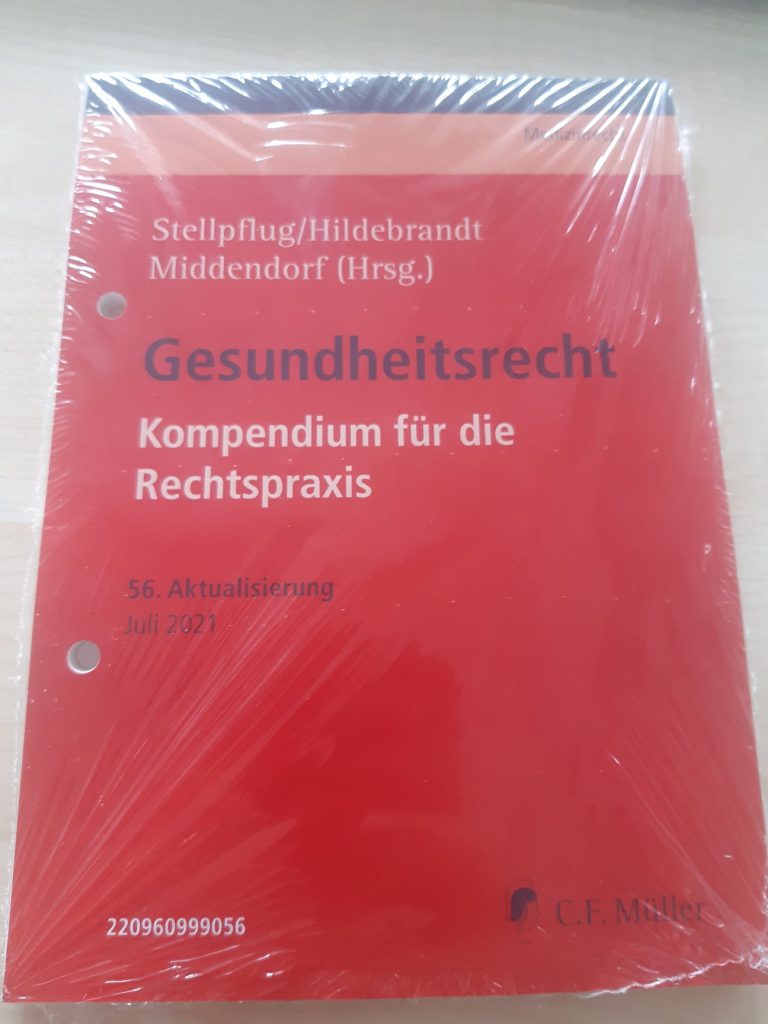
Beitrag Notfall- und Rettungsmedizin: Der Kompetenzbegriff
Unter dem Titel „Der Kompetenzbegriff – ein Aufruf zu mehr Differenziertheit“ erscheint in der Ausgabe 2/2021 der Zeitschrift Notfall- und Rettungsmedizin ein Beitrag, zudem auch ich einen (bescheidenen) Beitrag leisten durfte.
Der Kerninhalt des Beitrags ist mir dabei sehr wichtig: Um die „Kompetenz“ von Rettungsfachpersonal wird momentan häufig diskutiert. Dabei wird aber der Begriff Kompetenz regelmäßig völlig unterschiedlich genutzt. Das Resultat: Wir kommunizieren aneinander vorbei.
Persönlich möchte ich ergänzen: Und der ein oder andere hält Lautstärke dabei für wichtiger als Sachinhalte.
Der Beitrag ist online bereits verfügbar, jedoch kostenpflichtig: https://doi.org/10.1007/s10049-021-00845-5
Beitrag Im Einsatz: Kinder und Jugendliche im Einsatzgeschehen
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Im Einsatz“ aus dem S&K-Verlag findet sich ein Beitrag von mir zum Thema „Rechtliche Betrachtung für Einsatzkräfte und Betroffene: Kinder und Jugendliche im Einsatzgeschehen“.
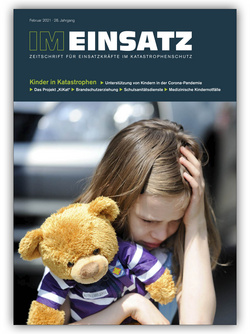
Ein Link zum Verlag findet sich hier.
In dem Beitrag befasse ich mich unter anderem mit minderjährigen NotSan-Auszubildenden und mit sonstigen minderjährigen Einsatzkräften.
„Noris nörgelt“ – Artikel zu arbeitsrechtlichen Dauerbrennern in der Zeitschrift Rettungsdienst
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Rettungsdienst aus dem S+K-Verlag beinhaltet einen Themenschwerpunkt „Rechtsfragen im Rettungsdienst“. Unter der Überschrift
„Noris nörgelt: Probleme mit Dienstplan, Überstunden und mehr“
habe ich mich mit arbeitsrechtlichen Dauerbrennern wie dem „Einspringen“, Überstunden durch Folgeeinsätze und dem Dienstplan auseinandergesetzt.