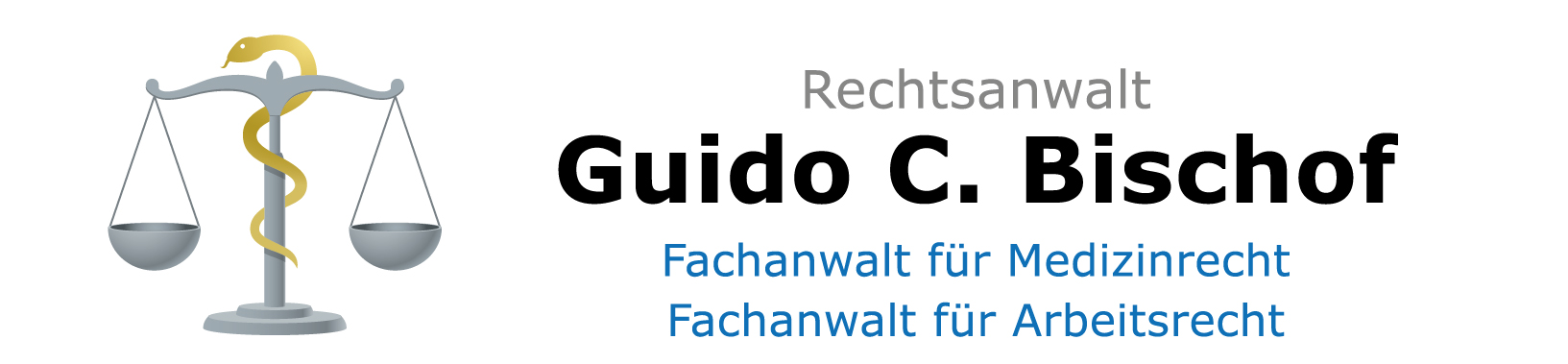Archiv
Rettungsdienst-Recht: Was tun, wenn der Patient erkrankt oder verletzt ist, aber nicht in das Krankenhaus will?
Wenn ich als Dozent auf Rettungsdienst-Fortbildungen unterwegs bin, höre ich manchmal als kurze selbstbewusste Antwort auf die Frage „Dann lasse ich den unterschreiben und gut ist“. Tatsächlich ist eine vom Patienten schriftlich bestätigte Transportverweigerung die „halbe Miete“.
In der Praxis ergeben sich aber zwei Probleme: 1. War der Patient überhaupt entscheidungsfähig und 2. Worüber wurden denn der Patient überhaupt aufgeklärt?
Die Entscheidungsfähigkeit
Einwilligungsfähig bzw. entscheidungsfähig ist, wer Bedeutung und Tragweite – auch die Risiken – der Maßnahme bzw. der Ablehnung der Versorgung erfassen und seinen Willen entsprechend einrichten kann.
Grundsätzlich ist zunächst jeder Volljähriger entscheidungsfähig. An der grundsätzlichen Einwilligungsfähigkeit bzw. Entscheidungsfähigkeit können sich verletzungs-, erkrankungs- oder situationsbedingt Zweifel ergeben. Insofern ist eine Einsatzdokumentation (Rettungsdienst-Protokoll) sinnvoll, die Anhaltspunkte für die Entscheidungsfähigkeit des Patienten enthält. Statt einem allgemeinem „Patient ist geschäftsfähig“ –was juristisch auch nicht der zutreffende Begriff wäre- empfehlen sich Feststellungen zur vollständigen Orientierung des Patienten. Idealerweise ist auch die Erhebung von Vitalwerten und ein weitgehender Ausschluss neurologischer Erkrankungen möglich. Natürlich sollten diese Feststellungen dokumentiert werden. Sofern sich insofern keine Auffälligkeiten ergeben, liegt Entscheidungsfähigkeit des Patienten vor.
Worüber wurde der Patient aufgeklärt?
Mir sind mehrere reale Fälle bekannt, in denen Patienten oder Angehörige später behaupten, es sei gar nicht oder nur unvollständig über die Folgen der Transport-Verweigerung informiert worden. Daher sollte ferner dokumentiert werden, über welche (Verdachts-)Diagnose und welche mögliche Folgen der Transportverweigerung der Patient aufgeklärt wurde.
Ein Beispiel
„Trotz momentaner Beschwerdefreiheit kann Gehirnblutung präklinisch nicht sicher ausgeschlossen werden, mögliche Folgen: Bewusstlosigkeit, bleibende Schäden (Schwerstpflegebedürftigkeit), Tod“
Verweigerungsformulare auf denen vorgedruckt steht, es sei über „alle Folgen“ aufgeklärt worden, sind insofern wenig hilfreich, da sie das oben skizzierte Problem nicht lösen. Auch die häufig verwandte Formulierung der Patient trage „die volle Verantwortung“ und könne niemanden haftbar machen, klingt kernig ist aber juristisch wenig hilfreich.
Die Dokumentation sollten daher auch Ausführungen enthalten, über welche möglichen Folgen der Patient aufgeklärt wurde.
Wieso den ganzen Schriftkram, wir sind doch zu zweit?
Richtig! Im Fall eines Strafverfahrens nämlich zwei Beschuldigte. Und Beschuldigten unterstellt man tendenziell, dass sie ihre Haut retten wollen und deshalb „Schutzbehauptungen“ aufstellen, auf deutsch: nicht die Wahrheit sagen.
Aber es steht doch „Aussage gegen Aussage“?
Es steht die Schilderung eines oder zweier Beschuldigter gegen ein Opfer und gegebenenfalls weitere Zeugen. Das ist im Strafrecht eine nicht untypische Situation die keinesfalls automatisch zum Freispruch bzw. zur Einstellung des Verfahrens führt.
Auch zivilrechtlich, also was einen Schadensersatzanspruch des Patienten angeht, besteht ohne ausreichende Dokumentation ein Haftungsrisiko zumindest für den Träger des Rettungsdienstes. Eine grob unvollständige oder gar komplett fehlende Dokumentation kann dann zur Beweislastumkehr bzw. Beweiserleichterungen für den Geschädigten führen.
Was tun?
- Versuchen den Patienten von der Behandlung/Beförderung zu überzeugen
- falls dies scheitert: gründliche Aufklärung über mögliche Folgen, gründliche Dokumentation der Aufklärung
Cannabis auf Rezept: Was tun bei Antrags-Ablehnung durch die Krankenkasse?
Seit über einem Jahr es die Möglichkeit, Cannabis als Medikament verschrieben zu bekommen. § 31 Absatz 6 SGB 5 regelt, dass Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen bei einer schwerwiegenden Erkrankung Anspruch auf Versorgung mit Cannabis haben. Voraussetzung ist, dass eine allgemein anerkannte dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht oder nicht zur Anwendung kommen kann.
Außerdem muss eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbar positive Entwicklung auf den Krankheitsverlauf oder schwerwiegende Symptome bestehen. Bei der ersten Verordnung des Cannabis durch den Arzt ist eine Genehmigung der Krankenkasse notwendig.
Krankenkassen lehnen Genehmigung von Cannabis-Versorgung häufig ab
Diese Genehmigung darf nach dem Wortlaut des Gesetzes nur in begründeten Einzelfällen durch die Krankenkasse abgelehnt werden. Die Realität sieht anders aus. Die Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meldete am 10. Januar 2018, dass im Durchschnitt etwa 37 Prozent der entsprechenden Anträge abgelehnt werden. Diese hohe Ablehnungsrate von mehr als einem Drittel entspricht auch der Wahrnehmung aus meiner anwaltlichen Tätigkeit.
Das Vorgehen der Krankenkassen bei der Ablehnung von Anträgen auf Cannabis der artiger Anträge sind sehr unterschiedlich.
Gelegentlich werden zunächst sehr ausführliche Anträge auf bestimmten Formularen verlangt. Dies führt soweit, dass medizinische Fachliteratur beigelegt werden soll. Der Antrag ist grundsätzlich formlos möglich. Erst Recht ist der Patient oder sein Arzt nicht verpflichtet, Auszüge aus Fachbüchern oder medizinischen Zeitschriften beizufügen.
Nach Eingang des Antrags bei der Krankenkasse holt diese häufig ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) ein. Die Qualität dieser Gutachten ist sehr unterschiedlich. Gelegentlich finden sich MDK-Stellungnahmen, die sich mit der Situation des Patienten sehr ausführlich auseinandersetzen und nachvollziehbar zu einer Entscheidung pro oder contra Cannabis-Therapie gelangen. In vielen Fällen wird in diesem MDK-Stellungnahmen die Cannabis-Therapie abgelehnt. Oft erfolgt dies lediglich mit Wiedergabe der Krankengeschichte, die dann folgende eigentliche Begründung ist kurz oder sehr pauschal. So kann angeführt werden, es existierten andere Therapien, ohne das diese konkret benannt werden. Mehrfach untergekommen ist mir auch die Begründung, es läge gar keine schwerwiegende Erkrankung vor bzw. es können nicht beurteilt werden, ob eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt.
Häufig entsteht der Eindruck, die MDK-Stellungnahmen dienen vorrangig dazu, eine Ablehung der Cannabis-Therapie durch die Krankenkasse zu begründen.
Was sollten Betroffene tun?
Gegen die Ablehnung des Antrags sollte auf jeden Fall Widerspruch eingelegt werden. Dies ist innerhalb eines Monats nachdem der ablehnende Bescheid eingegangen ist möglich. Nach dem Widerspruch holt die Krankenkasse in der Regel eine weitere Stellungnahme des MDK ein. Diese weitere Stellungnahme ist häufig auch negativ. Die Krankenkasse empfiehlt dann, den Widerspruch zurückzunehmen. Ich rate in solchen Fällen stets dazu, den Widerspruch aufrecht zu erhalten und gegen einen negativen Widerspruchsbescheid Klage einzureichen. Zwischenzeitlich sind diverse positive Gerichtsentscheidungen ergangen.
Gelegentlich haben Betroffene die Idee, keinen Widerspruch einzulegen oder den Widerspruch zurückzunehmen. Die Hoffnung dabei ist häufig, dass ein erneuter Antrag von der Krankenkasse bewilligt wird. Spätestens bei einem dritten oder vierten Antrag müsste die Krankenkasse den Antrag doch bewilligen. Diese Situation trifft aber selten ein. Im Gegenteil wirkt sich die erste Ablehnung häufig auch auf spätere Anträge negativ aus. Zudem geht bei der erneuten Antragstellung wichtige Zeit verloren.
Haben Sie Fragen zum Thema „Cannabis auf Rezept“ oder zum Gesundheits-Recht allgemein? Nehmen Sie gerne Kontakt auf!